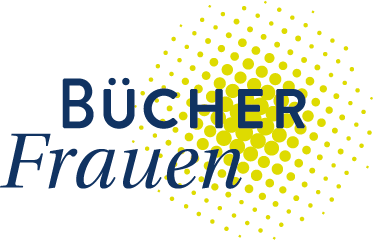Einige Berliner BücherFrauen haben sich im Juni zu einem gemeinsamen Filmbesuch getroffen, hier möchte ich die Geschichte des Films Ein Tag ohne Frauen nachzeichnen und dabei reflektieren, wie es gelingen kann, die Verhältnisse zu ändern: Dieser Film dokumentiert eine Revolution in Island, den Startpunkt von Reformen im Handeln, Denken und der Politik und die Möglichkeiten, die entstehen, wenn mit einfachsten Mitteln und fantasievoll eine andere Zukunft erdacht wird. Island ist heute das Land mit der höchsten Quote an Gleichberechtigung laut dem Global Gender Gap Report 2025 (Deutschland ist um einen Platz abgestiegen auf Platz 10). Wie es dazu kam, davon handelt der Film The Day Iceland stood still, wie er im Original heißt.
Wie startet eigentlich eine Revolution?
Island war ein sehr patriarchales Land, als 1975 im von der UNO ausgerufenen Jahr der Frauen in Reykjavik eine Konferenz abgehalten wurde. Zuvor schon gab es im Land Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzten, die sogenannten „Rotsocken“. Sie forderten gleichen Lohn für gleiche Arbeit und mehr Mitbestimmung in Politik, Verbänden, Kammern und Organisationen. In einer so kleinen Gesellschaft wie Island war das revolutionär, bis heute leben so wenige Menschen in Island, dass eigentlich alle miteinander verwandt sind, sich kennen oder zumindest jemanden kennen, die die Person kennen. Die Rotsocken waren gesellschaftlich nicht sehr angesehen und teilweise Anfeindungen ausgesetzt. Doch auf der Konferenz schafften es einige Frauen, die Idee eines Streiks zu verbreiten – ein Tag, an dem alle Frauen die Arbeit niederlegten. Mit Arbeit war nicht nur die Erwerbsarbeit gemeint. Auch die Haushaltsarbeit (vom Abwasch übers Stricken bis hin zum Zubereiten von Essen), die Care-Arbeit (Kinder und ältere bzw. pflegebedürftige Angehörige) und jegliche Form von Aktivität sollte niedergelegt werden.
Das war ziemlich radikal und die Auswirkungen waren für Island an jenem 24. Oktober 1975 deutlich spürbar: Zu Hause gab es kein Frühstück, die Kinder wurden zu den Arbeitsplätzen der Männer gebracht, Geschäfte blieben zu, es gab kein Telefon, die Flüge wurden gestrichen, auf Schiffen, in Fabriken, im Radio und Fernsehen – überall musste der Verlust ausgeglichen werden oder das System brach schlicht an diesem Tag zusammen. Allen war plötzlich bewusst, was Frauen leisten in der Gesellschaft, in der Erwerbsarbeitswelt und zu Hause. Niemand in Island entkam an diesem Tag den Folgen des „Freien Tags“ der Frauen. Ziemlich revolutionär.
Oder wie werden Reformen angestoßen?
Frauen aus dem ganzen Land kamen am Streik-Tag nach Reykjavik, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Es war die größte Demonstration, die Island je erlebt hat. Sie sprachen auf der Bühne von ihren Vorstellungen einer gleichberechtigten Gesellschaft und sie hatten ein Lied, das sie gemeinsam sangen: „Ich traue mich, ich kann, ich werde es tun!“
Im Jahr nach dem Streik verabschiedete Islands Parlament ein Gesetz zur Gleichstellung der Frauen und fünf Jahre später hatte Island die weltweit erste Präsidentin (Vigdís Finnbogadóttir). Frauen kamen nach und nach in immer mehr Verantwortung und Positionen, die ihnen zuvor verschlossen waren. Der Streik führte dazu, dass dieser notwendige Wandel von weiten Teilen der Gesellschaft mitgetragen wurde: „Wir wollen nicht eure Stellen, wir wollen mit euch gemeinsam das Land gestalten“, war die Forderung. Ein modernes Island entstand. Eine Einschränkung sei hier erwähnt – auch wenn Island heute Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung ist, eine volle Gleichstellung ist bis jetzt auch dort nicht erreicht: Es existiert ein Gender Pay Gap, das Parlament ist nicht paritätisch besetzt (immerhin 48 % Frauenanteil, das bringt Island weltweit auf Platz 9, Deutschland ist seit der letzten Wahl – 32,4 % Frauenanteil – auf Platz 58 abgesackt), in der Wirtschaft sind Frauen bis heute selten in Führungspositionen.
Oder wie kann ein Handeln mit einfachsten Mitteln eine große Wirkung entfalten?
Was braucht es, damit so ein Wandel gelingt, habe ich mich nach dieser Geschichte gefragt. Zum ersten empfinde ich den Protest als sehr mutig. Die einzelnen Frauen haben sich zusammengeschlossen und haben darauf vertraut, dass die anderen auch mitmachen – für jede Einzelne stand möglicherweise ein Jobverlust, ein Eheaus oder die Ächtung durch die Familie auf dem Spiel. Aber sie sahen sich als Gemeinschaft, die etwas erreichen wollte, was ihnen zustand. Daraus zogen sie ihre Kraft.
Zum zweiten ist es der Enthusiasmus einzelner Frauen, der die anderen mitriss. Sie hatten Energie und wollten eine bessere Gesellschaft. Dafür verbrachten sie ungezählte Stunden damit, Treffen zu organisieren, Flugblätter zu schreiben, Telefonate zu führen und die Sache voranzubringen. Sie ließen sich nicht von ihrem Ziel des Streik-Tags abbringen und setzten alle Ressourcen, die ihnen zur Verfügung standen, dafür ein.
Weiter finde ich den pragmatischen Ansatz auffällig. Die Frauen fanden Lösungen, wenn Probleme auftauchten, sie blieben nicht beim Problemdenken und sie gaben auch nicht auf, nur weil es mal nicht so ging, wie gedacht. Beispielsweise passte einigen konservativen Frauen das Wort „Streik“ nicht. Also wurde es kurzerhand umbenannt in „ein freier Tag“. Damit konnten alle leben, ohne dass der Sinn des Tages verloren ging. Solche Annäherungen aneinander brauchten ein flexibles Denken und einen gemeinsamen Fokus: Wo wollen wir hin und wie können wir möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren? – Das waren vielleicht die Aspekte, auf die es im Kern ankam.
Fazit
Der Film kann als Dokumentation gesehen werden – der Tag, an dem die Frauen Island zu mehr Gleichberechtigung inspirierten. Es kommen beeindruckende Frauen zu Wort und es werden starke Biografien nachgezeichnet. Durchsetzt mit historischen Aufnahmen werden die Frauen heute interviewt. Verbunden werden die Teile auch durch gezeichnete Elemente, die das Gesagte in Bilder fassen.
Die im Film dargestellten Frauen und ihre Vorgehensweisen können ein Vorbild für das eigene Leben und Handeln sein. Doch für mich kann dieser Film noch viel mehr: Er macht Mut, selbst Revolutionen anzustoßen, damit es mehr Gleichberechtigung in der Welt gibt, mehr Zusammenhalt und Verbindung zwischen den Menschen und starke Gemeinschaften, die auf positiven Visionen für eine bessere, friedvollere und zukunftsgerichtete Welt basieren.
Ein Tag ohne Frauen (Originaltitel: The Day Iceland Stood Still). Regie: Pamela Hogan & Hrafnhildur Gunnarsdóttir. Land: Island, USA 2024. Länge: 70 Min. Kinostart: 13.03.2025. FSK: 0. Aktuelle Spieldaten und Informationen unter: https://riseandshine-cinema.de/portfolio/ein-tag-ohne-frauen/
Eine Film-Besprechung von Meiken Endruweit, www.meikenendruweit.de