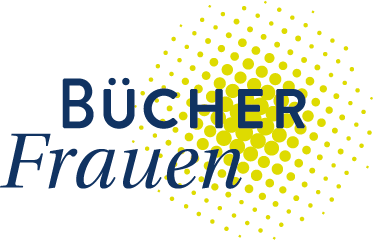Vorauszuschicken ist, dass Schorndorf mit seinem historischen Altstadtkern eine
ausgesprochen malerische Stadt ist, die mehr als einen Besuch lohnt.
Unsere freundliche, kompetente Stadtführerin Sabine Welter von der
Frauengeschichtswerkstatt Schorndorf stellte uns elf bemerkenswerte Frauen aus sechs
Jahrhunderten vor, die in der einen oder anderen Weise mit der Stadt verbunden waren.
Im Mittelalter
Wir begannen mit Elisabeth Schrinerin (gest. 1477), die als Inschrift an der Giebelwand der
Stadtkirche verewigt wurde. Auch das Tabernakel der Kirche trug diese Inschrift, daher
vermutet man, dass Elisabeth Schrinerin eine Stifterin der Kirche war.
Neben der Kirche stand ursprünglich die Schorndorfer Klause, für die Seel- und
Betschwestern, die den Franziskanerinnen nahe standen, vergleichbar einem Beginenhaus.
In einem Inventar von 1538 wird das Eintrittsvermögen der Barbara Schertlin (1496–1575)
mit 280 Gulden aufgeführt. Die Betschwestern verrichteten soziale Dienste und sicherten
durch ihre Webstube und andere Tätigkeiten ihre finanzielle Unabhängigkeit.
Vom Bauernaufstand (1514)
Am heutigen Eselsbrunnen verlief die Stadtmauer. Dort erinnerten wir uns an den
Bauernaufstand „Armer Konrad“ von 1514. Namentlich dokumentiert sind nur die Männer bis
auf eine Ausnahme: Katrina Böschin. Da ihr Mann Utz Entenmayer sich der Verurteilung
durch Flucht ins Ausland entzogen hatte, sollten alle ihre Besitztümer beschlagnahmt werden,
So richtete sie ein – vergebliches – Gnadengesuch an Herzog Ulrich, er möge Gnade vor
Recht walten lassen und ihr ihr Hab und Gut lassen oder ihr zumindest erlauben, zum
Unterhalt für sich und ihre Kinder darüber verfügen zu dürfen.
Barbara Künkelin und die Schorndorfer Weiber
Dass Schorndorf als einzige von sieben unter Herzog Ulrich ausgebauten Landesfestungen
nicht vom französischen Heer im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697) geschleift und
niedergebrannt wurde, verdankt die Stadt dem Mut und der Tatkraft von Barbara Künkelin
(1651–1741), Ehefrau des damaligen Bürgermeisters. Als von Stuttgart Gesandte mit der
Order, die Stadt kampflos preiszugeben, im Rathaus noch mit dem Gemeinderat berieten,
aktivierte Barbara die Schorndorfer Weiber und gemeinsam schlossen sie die Männer für zwei
Tage und drei Nächte im Rathaus ein. Es stellte sich heraus, dass die Franzosen gar nicht in
der Lage waren, die Stadt zu erobern und schließlich abzogen. Barbara, die ohne eigene
Kinder geblieben war, verwendete gegen Lebensende ihr Vermögen für eine Stiftung, die
mittellose Studenten mit Stipendien unterstützte, unter ihnen der Philosoph Friedrich Wilhelm
Joseph Schelling.
Vom 18. zum 19. Jahrhundert
Die Tochter des Oberamtmanns Gottlieb Friedrich Paulus Karoline Paulus (1767–1844)
wuchs mit zehn Geschwistern auf und erhielt mit ihren Brüdern eine gute Schulbildung. Sie
war so unabhängig, dass sie ihrem Vetter H. E. G. Paulus quasi einen Heiratsantrag machte.
1787 zog das Ehepaar nach Jena, wo ihr Mann eine Stelle an der Universität als Orientalist
erhielt. Die Familie war mit Schelling, Hegel, Schiller und Schlegel befreundet. 1805 erschien
Karolines erster Roman „Wilhelm Dümont – ein einfacher Roman“, noch unter dem
Pseudonym Eleutherie Holberg. Die folgenden fünf Romane veröffentlichte sie mit gutem
Erfolg unter ihrem eigenen Namen.
Die Tochter des Stadt- und Amtsschreibers Christian Gottlieb Schmid Rosine Schmid,
genannt Rösle, (1765–1809) durfte am Unterricht ihrer Brüder (durch H. E. G. Paulus)
teilnehmen und erhielt so eine grundlegende Bildung. Über Paulus lernte sie dessen
Studienfreund Jakob Friedrich Abel kennen und lieben. Als Abel als Professor nach Tübingen
berufen wurde, lernte sie 1798 Julie von Mai kennen. Diese hatte sich schon früh für eine
höhere Bildung für Mädchen eingesetzt. Zusammen gründeten sie das „Institut für
Frauenzimmer“, eine Privatschule, die 1818 endlich auch vom Staat anerkannt wurde.
Zu den bekannteren Frauen aus Schorndorf gehört auch die Malerin Ludovike Simanowiz,
geb. Reichenbach (1759–1827). Ihr Schillerporträt hat sie berühmt gemacht. Geboren wurde
sie im Burgschloss, da ihr Vater Regimentsarzt von Herzog Carl Eugen war. Nach drei Jahren
zog die Familie mit dem Herzog nach Ludwigsburg, in die Nachbarschaft der Familie
Schiller. Nachdem ihr malerisches Talent erkannt wurde und sie eine Grundausbildung
erhalten hatte, finanzierte der Herzog ihre weitere Ausbildung in Paris. 1791 kam sie zurück
und heiratete ihren Jugendfreund Franz Simanowiz. Ein nochmaliger Aufenthalt zu
Studienzwecken in Paris folgte. Da ihr Mann 1799 einen Schlaganfall erlitten hatte,
finanzierte sie den Unterhalt der Familie unter Skrupeln 28 Jahre lang durch ihre Arbeit als
Berufsmalerin, vor allem mit Porträts. Sie stand in regem brieflichem Austausch mit der
Journalistin Therese Huber, Schillers Schwester Christine Reinwald und der Pianistin Regine
Vossler. Von ihren Zeitgenoss:innen erhielt sie den Beinamen ‚Zauberin der Farben’.
Im 20. Jahrhundert
Emma Bäuchle (1882–1949) widmete ihr ganzes Leben ab 1903 ihrer Lehrtätigkeit als
Handarbeitslehrerin. Da ihr Vater Karl Bäuchle Hauptlehrer an der Schorndorfer
Mädchenschule, heute Schlosswallschule, war, wuchs sie in der Schule auf. Emma Bäuchle
unterrichtete in der Ganztagesschule, „Arbeitsschule“ genannt, mit 38 Wochenstunden bis zu
60 Schülerinnen am Tag,. Da das sogenannte Lehrerinnenzölibat galt, blieb sie unverheiratet.
Nebenbei spielte sie als Hilfsorganistin jahrelang die Orgel in der Stadtkirche. Sie starb 1949
wenige Wochen vor ihrem Eintritt in den Ruhestand.
Auf dem Alten Friedhof trafen wir auf das Familiengrab der Familie Maier. Selma Maier
(1892–1990), die Schwester des Ministerpräsidenten Reinhold Maier, besuchte zusammen mit
ihrer jüngeren Schwester Emma die Oberrealschule in Esslingen und legte dort 1914 das
Abitur ab. Eigentlich wollte sie Architektur studieren, entschied sich dann aber wie ihre
Schwester für Pharmazie. Die beiden waren die ersten Apothekerinnen in Württemberg.
Selma war überzeugte Homöopathin und baute diesen Zweig in der Stuttgarter Hofapotheke
mit auf. Noch heute ist die Hofapotheke ein Zentrum für Homöopathie. Nach dem Tod ihres
Schwagers und der schweren Erkrankung ihrer Schwester wechselte sie nach Ravensburg und
übernahm später die Liebendörfer’sche Löwenapotheke. 1932 eröffnete sie in Leutkirch die
Elisabethen-Apotheke, ebenfalls in homöopathischer Ausrichtung. Ihr Grabmal hat sie selbst
entworfen. Es symbolisiert Welt und Dornenkrone. Sie veranlasste auch eine Inschrift für ihre
Schwägerin Dr. Ilse Beisswanger auf dem Grabstein.
Am Bahnhof betrieb Rosa Kamm, geb. Baumhauer (1907–1996) in den 1920er Jahren bis
1939 ihr ‚Ständle’, einen Kiosk, am Bahnhof. Sie war schon früh engagierte
Sozialdemokratin. 1931 nahm sie an einem Treffen der sozialistischen Arbeiterjugend teil, der
unter dem Motto „Hitler = Krieg“ stand. In den Jahren 1933 bis 1945 musste die Familie
sieben Hausdurchsuchungen durch die Gestapo ertragen, ihr Mann kam zeitweise ins KZ.
Rosa Kamm nahm nach dem Krieg ihre politische Arbeit wieder auf und wurde als eine von
sieben weiblichen Abgeordneten (bei 93 Männern) in die verfassungsgebende Versammlung
von Württemberg-Baden gewählt. Sie war sportbegeistert, leitete die Arbeiterwohlfahrt und
engagierte sich als Gemeinderätin für das Krankenhauswesen.
Neben dem Rathaus im ehemaligen Gasthof Löwen wuchs Dr. Ilse Beisswanger (1903–1985)
mit Mutter und Bruder auf. Ihre Mutter hatte nach dem Tod des Vaters die Leitung von
Brauerei und Gaststätte übernommen. In Stuttgart ging Else aufs Mädchengymnasium und
studierte anschließend Jura. 1929 begann sie ihre berufliche Karriere als stellvertretende
Amtsrichterin in Stuttgart, wurde aber 1932 entlassen, arbeitete anschließend als
Rechtsanwältin, bis sie endgültig mit Berufsverbot belegt wurde. Nach dem Krieg wurde sie
als unbelastete Juristin 1946 als Spruchkammervorsitzende eingesetzt, wechselte dann ans
Landgericht und beendete ihre Laufbahn als Landgerichtsdirektorin. Sie wurde auf eigenen
Wunsch anonym auf dem Stuttgarter Waldfriedhof beigesetzt. Eine Inschrift auf dem
Familiengrab in Schorndorf erinnert an sie.
Unsere letzte Station führt uns zurück in die Obere Hauptstraße 22 zu Marie Schmid, geb.
Vreede (1814–1901). Sie war tiefreligiös. Nach dem Tod ihres Mannes 1839 und nachdem ihr
Sohn bereits als Baby und ihre Tochter im Alter von 46 Jahren verstorben waren, stand sie
ohne Erben da. So verfügte sie, dass ihr Haus nach ihrem Tod den Pfarrtöchtern dienen sollte.
Diese hatten – wenn unverheiratet – die Pflicht, den Vater im Alter zu versorgen und nach
seinem Tod entweder den Pfarrnachfolger zu heiraten oder im Alter abhängig von den
Geschwistern zu sein. Mit ihrer Stiftung ermöglichte Marie Schmid den Pfarrtöchtern einen
würdigen Lebensabend, zunächst für 10 bis 12 Frauen. Es zeigte sich bald, dass ein hoher Bedarf
an Plätzen bestand und ein Nachfolgebau benötigt wurde. Heute bietet das Altenheim
Marienstift in der Johann-Philipp-Palm-Straße Platz für 80 Bewohnerinnen.
Damit endete der spannende und unterhaltsame Spaziergang auf den Spuren Schorndorfer
Frauen.
Text: Barbara Scholz